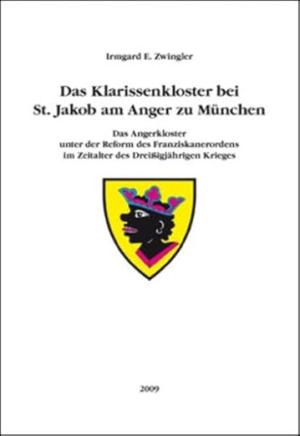Stadtgeschichte München
Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Münchner Bücher
Das Klarissenkloster bei St. Jakob am Anger zu München
das Angerkloster unter der Reform des Franziskanerordens im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges
Zwingler Irmgard E.
Inhaltsverzeichnis
Ungedruckte Quellen
Siglen und Abkürzungen
Gedruckte Quellen und Literatur
Einführung
Teil I Ordensgeschichtliche Grundlegung und Klosterreform Maximilians I.
- Der Klarissenorden und das Angerkloster vor dem 17. Jahrhundert
- Klara von Assisi (1193/94-1253) und die Entwicklung der Ordensregel
- Klara von Assisi und Franziskus
- Erste Regel für die Gemeinschaft Klaras
- Regel Klaras von 1253
- „Isabella-Regel” - Wegbereiterin für die Urbanregel
- Regel Papst Urbans IV. von 1263
- Gründung des Angerklosters in München 1284
- Die erste franziskanische Niederlassung bei St. Jakob
- Die ersten Klarissen am Anger
- Gründung ohne Fundation
- Bedeutung des Adels für das Angerkloster
- Cura monialium - Schutz und Aufsicht über die Klarissen
- Die Klarissen unter dem besonderen Schutz des Papstes
- Rechtlicher Schutz durch Kardinalprotektoren
- Existenzsicherung durch päpstliche Privilegien - Betreuung der Frauenklöster durch den Ersten Orden im 13. Jahrhundert
- Das Angerkloster unter der Observantenbewegung
- Nachlassen der Regelbeobachtung - Schwerpunkte der Betreuung im 16. Jahrhundert
- Betreuung und Statuten
- Sichere Existenz und Disziplin - Betreuung in der Oberdeutschen Observantenprovinz - Beispiele
- Klausurfragen
- Betreuung und Beichtvateramt
- Die Klarissen unter dem besonderen Schutz des Papstes
- Klara von Assisi (1193/94-1253) und die Entwicklung der Ordensregel
- Grundlagen für die Reform des Franziskanerordens in Bayern im 17. Jahrhundert
- Ordensgeschichtliche Situation innerhalb der Observanten
- Cismontane und ultramontane Ordensfamilie
- Neue Reformgruppen
- Discalceaten und Rekollekten
- Reformaten
- Initiativen zur katholischen Reform im Umfeld des Angerklosters
- Kaisertöchter in Hall in Tirol statt im Ridlerkloster
- Gründung eines Tochterklosters in Wien
- Gründung eines Tochterklosters in Graz
- Die religiöse Situation in der Steiermark
- Maßnahmen Erzherzog Karls 11. (1564/65-1590)
- Maßnahmen Erzherzogin Marias (1571-1608)
- Die Kirchenpolitik Maximilians I.
- Die Kirchenpolitik bayerischer Herzöge
- Maximilians Klosterreformpolitik
- Reform des Seraphischen Ordens - Ziel einer landesherrlichen Maßnahme
- Ordensgeschichtliche Situation innerhalb der Observanten
- Die Reform des Seraphischen Ordens durch Maximilian I.
- Das Angerkloster - eigentlicher Auslöser zur Reform?
- Erste Initiative Maximilians 1605
- Intervention in Rom
- Jacobus Farcin als päpstlicher Legat - Zweite Initiative Maximilians 1609
- Päpstlicher Auftrag an die Inquisition
- Auftrag des S. Officium zu weiterer Visitation
- Zur Problematik der Datierung - Gezielte Aktivitäten Maximilians
- Giovanni B. Crivelli - Resident Maximilians in Rom
- Vorlage eines Reformkonzeptes in Rom 1614
- Bemühung um Ermächtigung zur GeneralVisitation
- Langwierige Verhandlungen
- Neuer Impuls zur Durchsetzung des Konzeptes
- Erste Initiative Maximilians 1605
- Beginn der Reform 1620
- P. Antonius a Galbiato als Generalkommissar in München
- Ankunft und erste Maßnahmen
- Heftige Reaktionen im Münchener Konvent
- Widerstand und Protest der Provinzleitung
- Abwanderung von Novizen - Verlauf der Reform in Bayern
- Die Reform in München
- Die Reform der übrigen Konvente in Bayern - Die Kustodialkapitel in Bayern 1622-1625
- Auswirkungen der Reform in Bayern - Erster Orden
- Armutsfrage und Syndikus
- Verwaltung von Almosen durch den Zweiten Orden
- Praxis des Syndikus ab 1638
- Herzogliche Almosen für die Franziskaner - Dritter Orden und Reform - der Weg zur strengen Klausur
- Ridler und Pütrich - Regulierung durch den Herzog 1484
- Nuntius Ninguardas erfolglose Intervention 1581
- Strenge Klausur durch Antonius a Galbiato 1621-1627
- Päpstliche Bestätigung der Klausur 1628
- P. Antonius a Galbiato als Generalkommissar in München
- Gründung der Bayerischen Franziskanerprovinz 1625 und ihre Entwicklung bis 1630
- Maximilians Schritte zum Erfolg
- Zwei neue Reformkonvente
- Detaillierte Anweisungen an den Residenten
- Programmatische Forderungen an Urban VIII. 1624
- Errichtung der exempten Bayerischen Reformatenprovinz am 1. März 1625
- Hohe Ordensämter für zwei Reformator! aus der Bayerischen Provinz - Nachfolge im Amt des Residenten in Rom
- Folgen der Abtrennung von der Observantenprovinz
- Wachsender Unmut
- Einberufung eines Kongresses nach Graz 1629
- Ergebnisloser Verlauf der Grazer Versammlung
- Päpstliche Besiegelung der Abtrennung 1630
- Gescheiterter Einigungsversuch in Augsburg 1630
- Antonius a Galbiato in päpstlicher Mission auf dem Kurfürstentag in Regensburg - Die Reform Maximilians gerät zum Politikum 1631-1633
- Streben nach Sicherung der Reform
- Maximilians Wunschkandidat für das Amt des Ordensgenerals
- Verschiebung und Verlegung des Generalkapitels von 1631
- Wachsende Spannungen im Vorfeld
- Vorkehrungen des Papstes - Das Generalkapitel in Toledo 1633
- Inhaftierung des Kandidaten Antonius a Galbiato
- Feierlicher Verlauf des Pfingstkapitels 1633
- Wahl des Gegenkandidaten - Der Wahlskandal von 1633 in der franziskanischen Ordenshistoriographie
- Streben nach Sicherung der Reform
- Fortgang des Reformwerkes ab 1633
- Amtsverlust für Generalkommissar Ambrosius
- Maximilians Ablehnung eines Nationalkommissars
- Erneute Stärkung der Reform
- Das Ende der italienischen Herrschaft 1638
- Definitive Exemption der Provinzen Bayern und Tirol 1639
- Neue Gefährdung der Autonomie der Reformaten
- Fortbestand des Reformwerkes
- Entwicklung der Klöster in der Bayerischen Reformatenprovinz
- Würdigung Maximilians - Zeugnis Wittelsbachischen Selbstverständnisses
- Maximilian - ein zweiter Theodo
- Geschichtlicher Hintergrund
- Theodo III. und sein Bemühen um eine bayerische Kirchenprovinz
- Maximilian - Gründer einer unabhängigen Bayerischen Ordensprovinz - Ordensinteme Beurteilung der Reform
- Die beiden »Säulen« der Bayerischen Reform
- Bischof Antonius Arrigoni a Galbiato (1570-1636), Reformat und Reformer
- Ambrosius Spreaftco a Galbiato (+ 1639)
- Würdigung der Galbiaten Antonius und Ambrosius
- Würdigung im gesamten Orden
- Würdigung in der Bayerischen Provinz
- Maximilians Schritte zum Erfolg
- Das Angerkloster - eigentlicher Auslöser zur Reform?
TEIL II Das geistliche Leben im Angerkloster und seine Ausstrahlung auf die Stadt München
- Die Auswirkungen der Reform von 1620 im Hinblick auf die Statuten
- Entwicklung neuer Statuten bis 1685/98
- Enge Bindung der Klarissen an die franziskanische Reform
- Statutenentwicklung für den Ersten Orden
- Ordinationes provisionales 1621
- Statuta Provinciae Bavariae von 1639 bis 1662
- Abschließende Statuten 1698 - Statuten für den Zweiten Orden
- Statuten für die Klarissen in Bayern und Tirol 1635
- Fortschreibung und neue Bestimmungen 1644-1674
- Die Statuten von 1685 und ihr Aufbau - Die „Liebs-Congregation” - ein klosterinternes Statutenbuch
- Auslegung von Regel und Statuten durch Reformaten Italiens
- Geistliche Betreuung und Beichtväter im Angerkloster
- Vom „Vaterhaus” am Anger zur „Präsidenterey"
- Betreuung unter den Observanten
- Betreuung unter den Reformaten - Grundsätzliches
- Die Gemeinschaft der Brüder in der Residenz
- Unabhängiger Status
- Regelungen für Alltag, Festlichkeit und Todesfall - Das Beichtväteramt
- Ein Amt von hoher Wertschätzung
- Amtszeit in Theorie und Praxis
- Extraordinari-Beichtväter
- Fragen der personellen Erfassung - Würdigungen
- P. Johannes Ketterle (+ 1674)
- P. Barnabas Kirchhueber (1660-1705) - Beichtväter und Prediger seit der Reform von 1620
- Beichtväterreihe 1620-1705
- Prediger in der Klosterkirche St. Jakob
- Betreuung und Klausur
- Erfordernisse bei Klostergebäude und Kirche
- Zugang zum Nonnenkloster
- Geringfügige Veränderung der Bestimmungen 1620-1698
- Päpstliche Lizenz für den Adel
- Intervention Kurfürst Maximilians
- Intervention Herzog Maximilian Philipps
- Lockere Handhabung im Angerkloster - Weltliche Personen in der Klausur
- Erfahrungsaustausch unter Äbtissinnen
- Visitation durch die Ordensoberen
- Berechtigung
- Die jährliche Visitation durch den Provinzial
- Interne Anweisungen in spiritualibus
- Überprüfung in temporalibus - Außerordentliche Visitatoren
- Generalkommissare
- Generalminister - Visitationsdekrete für Wiener Klarissen - Exkurs
- Franciscus Sosa a Toledo 1603
- Petrus Marinus Sormano 1685 - Zuständigkeit des Bischofs
- Entwicklung neuer Statuten bis 1685/98
- Innere Struktur des Konventes
- Die Äbtissin im Urbanissenkloster
- Das Amtsverständnis
- Aufgaben der Äbtissin - innerer Bereich
- Pflicht und Verantwortung
- Maßnahmen
- Verteilung von Ämtern
- Kompetenz für Dispensen - Aufgaben der Äbtissin - äußerer Bereich
- Wirtschaftliche Existenzsicherung
- Rechtsvertretung durch den Schaffner - Wahl einer Äbtissin
- Sonderfall Angerkloster
- Abtei- und Konventsiegel
- Freie Resignation einer Äbtissin
- Pflichtgemäße jährliche Resignation
- Stimmberechtigung
- Zeremonie bei der alljährlichen Wiedereinsetzung
- Neuwahl und Inventur - Amtszeit der Äbtissin
- Idealvorstellungen und Praxis
- Intervention der Kurfürstin Maria Anna
- Das Amt der Priorin
- Aufgaben
- Amtsdauer
- Ausnahmesituation im Dreißigjährigen Krieg
- Der Weg zur Klarissin
- Regelungen vor der Aufnahme
- Anforderungen an Chor-und Laienschwestern
- Kontrakt über Mitgift und Erbe
- Aussteuer und Kosten - Einkleidung
- Vorläufigkeit auf beiden Seiten
- Feier der Einkleidung - Noviziat und Profess
- Betreuung der Novizinnen
- Bischöfliches Professexamen
- Kandidatinnen und ihre Professfeiern
- Professfeier für Chor-und Laienschwestern
- Professformel - Professeid
- Ausspeisung und Kosten - Der Konvent des Angerklosters im 17. Jahrhundert
- Schwesternverzeichnis 1600-1641
- Schwesternverzeichnis 1641-1701
- Schwesternliste 1702
- Reihe der Äbtissinnen im 17. Jahrhundert
- Reihe der Priorinnen
- Regelungen vor der Aufnahme
- Die Äbtissin im Urbanissenkloster
- Geistliches Leben im Angerkloster
- Die Reformstatuten von 1685 im Hinblick auf die Gelübde
- Gehorsam
- Armut
- Keuschheit und Zucht
- Klausur
- Das Gebetsleben - der „göttliche Dienst”
- Das Offizium und seine liturgische Ausgestaltung
- Das Stundengebet im Sinne der Reformaten
- Tagesplan zum Stundengebet
- Choralgesang und Einschränkungen 1620
- Kirchenordnung von 1627
- Verhalten im Chor - Messfeier - Konventamt und Jahrtage
- Seraphischer Orden und Kirchenjahr
- Liturgische Gestaltung - Beichte und Kommunionempfang
- Das Offizium und seine liturgische Ausgestaltung
- Gebetsverpflichtungen - Tradition und Vereinbarung
- Kapitelversammlungen des Ordens
- Gebet für die Fürstenhäuser
- Gottesdienste aus Gepflogenheit
- Gelöbnisse des Klosters in Kriegs- und Pestgefahr
- Gebetsverbrüderung
- Weitere regelmäßige Pflichtgebete
- Totengedächtnis für eine Klarissin
- Andere Frömmigkeitsformen im Kloster
- Verehrung des Allerheiligsten
- Kreuz- und Passionsfrömmigkeit
- Marien- und Heiligenverehrung
- Marienverehrung
- Franziskanische Heilige
- Als »Selige« im Angerkloster verehrte Klarissen - Reliquienverehrung im Angerkloster
- Eine spezifische Form der Heiligenverehrung
- Der Reliquienkalender 1692 - klosterinterner Gebrauch - Klosterbibliothek
- Gestaltung des Gemeinschaftslebens
- Verhalten bei Tisch
- Haartracht und Kleidung
- Fasten, Abstinenz und Mäßigkeit
- Allgemeine Gepflogenheiten
- Rigorose Haltung der Reformaten
- „Fleischordnung” 1689 - Briefkontakte zu anderen Klöstern
- Verehrungswürdige und Gottselige im Angerkloster
- Kriterien der Verehrungswürdigkeit
- Reihe der Gottseligen im 17. Jahrhundert
- Die gottselige Schwester Clara Hortulana von Empach (1662-1689)
- Herkunft und biographische Angaben
- Clara Hortulana im Kloster
- Einkleidung und Noviziat
- Sterbestunde und Tod
- Schockwirkung im Kloster - Geistliches Wirken
- Kämpfe und Visionen
- Errettung von Seelen aus dem Fegfeuer - Clara Hortulana im-Ruf der Heiligkeit
- Erhebung der Gebeine 1698
- Bemühung um zuverlässiges Zeugnis - Kurfürstliche Beatifikationsbestrebungen
- Prinzessinnen Agnes und Barbara im Vordergrund
- Einbeziehung des Freisinger Bischofs
- Erhebung der Gebeine der Prinzessinnen
- Zeugenvernehmung im Kloster 1701
- Fortgang der Beatifikationsbemühungen 1701-1703 - Gebet, Hymnus und Attestatum
- Die Reformstatuten von 1685 im Hinblick auf die Gelübde
- Franziskanische Volksseelsorge in St. Jakob
- Portiunkula- und Lateranablass - zwei „große Gnaden”
- Ablassprivilegien und Seraphischer Orden
- St. Jakob und der Portiunkula-Ablass
- Ursprung und Verleihung 1401
- Wechselnde Wertschätzung und Wiederbelebung
- Streitigkeiten
- Dominikus-Ablass als praktikable Interimslösung 1688
- Erneuerung des Portiunkula-Ablasses 1703 - St. Jakob und die Lateranensische Inkorporation 1607
- Wertschätzung des Ablasses
- Erneuerung mit Konsens des Ortsbischofs
- Streitigkeiten mit dem Ridlerkloster 1689-1700
- Verehrung von Reliquien und Heiligen Leibern in St. Jakob
- Katakombenheilige und Märtyrerkult in Rom
- Bestand und Zuwachs an Reliquien und Heiligen Leibern
- Die bedeutendsten Heiltümer in St. Jakob
- Die Katakombenheiligen Eutychia und Justinus - vom Erwerb bis zur öffentlichen Verehrung
- Kauf in Rom und Transport nach München
- Rekognition und Approbation
- Heilige Leiber und Klosterarbeiten
- Die Translationsprozession - ein Stadtereignis
- Salutationsfeier S. Eutychiae
- Die Ausstattung der Schreine
- Bitteres Nachspiel
- Weitere Heilige Leiber für St. Jakob
- „Signum veritatis S. Eleutheriae" - ein Mirakel
- Klosterkirche St. Jakob
- Besondere Feiertage und ihre Gestaltung
- Gnadenbilder
- Kirchengebäude und Ausstattung
- Umbau des Kircheninneren 1642
- Teilrenovierung 1673/74
- Renovierung 1681
- Laufende Kosten - Zwei neue Monstranzen
- Ikonographisches Programm
- Finanzierung
- Gestaltung und Kosten
- Stiftungen - Bedeutung für Kloster und Gläubige
- Seelgerätstiftungen
- Begriff und Intention
- Formen der Vereinbarung - Verpflichtungen von unterschiedlichem Umfang
- Allgemeine Unterscheidungen
- Die Jahrtagsstiftung Peringer 1640
- Die Ewige Wochenmessstiftung Töpstl 1666
- Jahrtage für Eltern einer Konventualin - Buchführung über die Verpflichtungen
- Das Jahrtagsbuch
- Das Jahrtagslibell von 1624
- Die zwölf großen Totenvigilien
- Versäumte Pflichterfüllung - eine moralische Last - Erbschaften und Vermächtnisse
- Stiftungen von unterschiedlicher Größenordnung
- Hoher Verwaltungsaufwand
- Stiftungen von Pfründnerinnen
- Geistlichkeit als Stifter
- Die Fürstenhäuser Wittelsbach und Habsburg als Stifter - Stiftungen zum Kirchenschatz
- Seelgerätstiftungen
- „Der Mitleidige Seelenbund” in St. Jakob
- Die Bedeutung von Bruderschaften im Volk
- Gründung 1681
- Das Kloster - Gastgeber und Mitglied
- Mitgliederzahl und Verwaltung
- Der „Zeigungsbrief” - Beitrittsurkunde von 1681
- Satzung
- Streit mit der Erzbruderschaft vom Alten Hof
- Befürchtete Konkurrenz
- Klage beim Bischof
- Einschaltung Roms
- Erfolg dank prominenter Verteidigung
- Die Jakobidult
- Ursprung
- Aufblühen durch religiösen Anlass
- Wirtschaftliche Bedeutung für Stadt und Kloster
- Herstellung und Verkauf von Devotionalien - Streitigkeiten mit der Stadt
- Sepulturstreit mit der Pfarrkirche St. Peter
- Bedeutung des Begräbnisrechtes für den Seraphischen Orden
- Sepultur im Klosterfriedhof von St. Jakob
- Gängige Verfahrensweise
- Spannungen
- Sorge um pfarrliche Rechte 1692 - Anhaltende Sepulturstreitigkeiten
- Beerdigung der Maria Justina Pilmes 1698 als Auslöser
- Briefwechsel mit Freisinger Instanzen
- Appell des Bischofs an das Salzburger Konsistorium 1699
- Weitere Streitigkeiten 1729-1741
- Portiunkula- und Lateranablass - zwei „große Gnaden”
- Mary Wards Attestierung im Angerkloster
- Zur Person Mary Wards
- Die Haltung Kurfürst Maximilians
- Der Aufenthalt Mary Wards im Angerkloster 1631
TEIL III Die Klosterökonomie - ein komplexes System
- Das Rechtsverhältnis des Angerklosters zur weltlichen Obrigkeit
- Rechtlicher Schutz und Privilegien
- Entwicklung zum landständischen Kloster
- Praxis des Rechtsbeistands im 17. Jahrhundert
- Der Commissarius Protector
- Bestätigung der Privilegien
- Verpflichtung als Prälatenkloster
- Repräsentative Pflichten
- Dienstleistungen des Klosters
- Der Besitz des Klosters und seine Nutzung im 17. Jahrhundert
- Existenzsicherung durch grundherrschaftlichen Besitz
- Erwerb durch Kauf in der Gründungsphase
- Besitzzuwachs durch Seelgerätstiftungen
- Die Liegenschaften des Angerklosters
- Quellenlage
- Uneinheitliche Ansätze
- Verzeichnisse aus Initiative des Klosters
- Kurfürstliche Erhebung 1634/50 - Zusammenstellung der Liegenschaften
- Güter - nach Gerichten geordnet
- Mühlen
- Besitz im Burgfrieden Münchens
- Anger und Gärten unmittelbar vor der Stadt
- Der Vogelherd im „Pirket” in Thalkirchen - Besitzveränderungen im Verlauf des 17. Jahrhunderts
- Quellenlage
- Das Angerkloster als Grundherr
- Rechtliche Stellung zu den Untertanen
- Gerichtsbarkeit
- „Rechthalten” in Kösching - ein Sonderfall - Nutznießung der Güter durch Verstiftung
- Verschiedene Verleihformen
- Ausstände - Betrug - Streitigkeiten - Zehent
- Der Sendlinger Zehentstreit
- Rechtliche Stellung zu den Untertanen
- Der Dreißigjährige Krieg - eine schwere ökonomische Krise
- Wirtschaftlich-finanzielle Probleme 1632-1634
- Kosten der Fluchtunternehmung
- Fehlende Zinseinnahmen
- Eingeschränkte Ernährung
- Obdach für Flüchtlinge
- Verwüstung der meisten Güter
- Ausstände - summarisch - Unterstützende Maßnahmen des Klosters
- Direkthilfe
- Flexible Verstiftungspraxis als langfristige Maßnahme - Die Kriegsjahre 1646-1648
- Langsame Besserung nach 1650
- Wirtschaftlich-finanzielle Probleme 1632-1634
- Existenzsicherung durch grundherrschaftlichen Besitz
- Geldwirtschaft - Kapitalanlagen und Steuern
- Einführender Überblick
- Mitgift und Kapitalanlagen
- Anlagen bei der Landschafts- oder „Bunds-Cassa”
- Weitere Zinsansprüche des Klosters
- Einnahmen von der Stadt Hall in Tirol
- Einnahmen vom Hochstift Freising - Belastungen vonseiten des Landesherrn
- Die Steuerpflicht des Angerklosters
- Die „Ordinari-Steuer”
- Die „Extra-Ordinari-Steuer”
- Kriegskontributionen und Zwangsanleihen
- Gravamina auf dem Landtag 1669
- Besteuerung der Bedienstetenlöhne
- Die Päpstliche Türkensteuer ab 1684
- Die Erfassung der Naturalwirtschaft
- Anfängliche Buchführung 1631/32
- Wochenzettel
- Gültbuch mit Jahressummen
- Bilanzierende Buchführung ab 1700/01
- Rechnungsbuch der Äbtissin
- Bilanz an Naturalien zur Inventur 1700/01
- Wirtschaftliche Sonderposten
- Gelddienste für andere Klarissenklöster
- Spezielle Einnahmen
- Opferstock
- Einnahmen vom Seelenbund - Ausgaben
- Baumaßnahmen
- Geschenke und Verehrungen
- Getreide als Anerkennung - Zahlungsbefehl gegen das Kloster Kühbach
- Anfängliche Buchführung 1631/32
- Holzwirtschaft - Versorgung mit Baustoff und Energie
- Oberer und Unterer Nonnwald
- Güter im Oberen Nonnwald
- Nutzung des Oberen und Unteren Nonnwaldes 1635/40
- Regelung von Holzarbeit und Verkauf
- Holztransport nach München
- Die Wehre bei Wolfratshausen
- Begehung des Nonnwaldes 1669
- Nutzungsrecht im „Pairbrunner Forst"
- Geschichtlicher Hintergrund
- Streit mit dem Landesherrn
- Reichnisse für die Förster
- Der „Stadler” in Stockdorf
- Holzqualität
- „Aichelklauben” und Techel
- Holzdiebstahl und Frevel im Stadler
- Das „Pirkhet” in Thalkirchen
- Brennholzreserve
- Unregelmäßigkeiten und Betrug
- Oberer und Unterer Nonnwald
- Teichwirtschaft - Versorgung mit „Fastenspeis”
- Gewässer im Nonnwald - Nutzung und Organisation
- Betreuung durch Weihermeister
- Weiherräumung und Fischzucht
- Die „Stift” in der Fastenzeit
- Das „Fischet” im Herbst
- Ein Fest auf Kosten des Klosters
- Fischfang und Transport nach München - Zwischenlagerung in Fischweihern in der Au
- Fischwasser an der Amper bei Dachau
- Lieferbedingungen für die Fischer
- Störungen des Fischereirechtes
- Anfeindungen gegen das Kloster
- Gewässer im Nonnwald - Nutzung und Organisation
- Versorgung mit Wein
- Bedarf an „Opfer-und Speiswein”
- Bezug aus verschiedenen Regionen
- Weine aus Tirol und vom Neckar
- Weine aus Wien und der Wachau
- Kostspieliger Transport auf der Donau
- Dauer und Kosten des Transports .
- Reduzierung der Kosten durch Mautbefreiung
- Kooperation mit Kloster Tegernsee
- Hilfe durch Wiener Klarissenklöster
- Wein als „Allmusen” von S. Nicola
- Unterstützung durch das Königinkloster
- Der kurfürstliche Weinaufschlag 1620-1690
- Weinlagerung im Kloster
- Kloster und Klosterhof - das wirtschaftliche Zentrum
- Die Klosterschwaige Bruderhof
- Eigenbewirtschaftung und Verstiftung im Wechsel
- Wert und Nutznießung
- Ertrag und Kosten 1693
- Das Kloster als Arbeitgeber - Organisationsstruktur
- Einblick in Alltagsverhältnisse
- Dienste des Schaffners und des Verwalters
- Zentrale Bedeutung des Schaffneramtes
- Bewerbung um den Schaffnerdienst 1691
- Aufgaben in Verwaltung und Menschenführung
- Beispiel einer Amtseinführung 1633
- Besoldung und Zuwendungen
- Schaffner Praitenlochner - ein Ausnahmefall
- Schaffnerliste für das 17. Jahrhundert
- Der Verwalter an der Donau
- Der Kastenbauer in Reisgang - Bedienstete, Dienstboten und ihre Aufgaben
- Der Advocatus - ein externer Angestellter
- Brauwirtschaft im Angerkloster
- Brau-und Verkaufsrecht
- Bezug der Braustoffe
- Belastung durch den Bieraufschlag
- Gesonderte Verrechnung
- Kapazität und Lagerung
- Klosterbier - Konkurrenz für Münchener Brauer?
- Bier in verschiedenen Qualitäten und Funktionen
- Ruinöse Großzügigkeit bis 1740
- Leben am Klosterhof
- Haus-und landwirtschaftliche Grundsätze
- Getreideanbau und Lagerung
- Buchhaltung über den Verbrauch an Naturalien - Jahressummen von. Gült und Küchendienst 1636
- Gepflogenheiten bei der Übergabe der Gült
- Ernährung im Angerkloster
- Gesundheit und Klosterapotheke
- Kirchenjahr und Brauchtum im Klosterhof
- Haus-und landwirtschaftliche Grundsätze
- Die Klosterschwaige Bruderhof
- Soziale und rechtliche Berührungspunkte zwischen Kloster und Stadt
- Soziale Dienste und Reichnisse
- Dienst an Bedürftigen
- Jahrtagsausspeisungen
- Sorge für Arme und Sieche
- „Kosthafen” für Studenten und Hausarme - „Verehrung” an verdiente Helfer in der Stadt
- Dienst an Bedürftigen
- Der Klosterhof - ein rechtlich exempter Raum
- Das Sonderrecht auf Inventur
- Freiung im Klosterbezirk - sichere Zuflucht?
- Konflikte mit Magistrat und Bürgern
- Klosterbach
- Probleme durch benachbarte Bauten
- Belästigung von außen
- Kloster und Magistrat 1682
- Soziale Dienste und Reichnisse
Teil IV Das Angerkloster und der Dreißigjährige Krieg
- Der Konvent des Angerklosters auf der Flucht vor den Schweden 1632
- Die Flucht, eine große Herausforderung
- Planung der Ziele
- Vorbereitungen und Aufbruch
- Begleiter und Helfer
- Aufenthalt in Tölz
- Der Weg nach Hall
- Aufenthalt in Hall
- Neue Gefahr in Tirol
- Versorgung
- Geistliches Leben
- Jurisdiktion
- Tod des Beichtvaters - Rückkehr nach München
- Der Verlauf der Flucht 1632 - kursorischer Überblick
- Personelle Erfassung
- Fluchtberichte der Klöster Ridler und Pütrich
- Vergleich mit dem Kriegsschicksal anderer Konvente.
- Die Flucht, eine große Herausforderung
- Die Flucht der Klosterfrauen 1632 im Spiegel von Briefen
- Die wirtschaftlich-organisatorische Korrespondenz
- Persönliche Briefe
- Die Kriegschronik der Schwester Anna Catharina Frölich von Frölichspurg
- Erste Kriegsphase in Bayern 1632
- Die Jahre 1633-1635
- Der Französisch-Schwedische Krieg 1635-1648
- Kriegsende - Folgen für Bayern
Anhang
Bildteil
Register
Klöster in München, Klarissenkloster, Angerkloster, St. Jakob, Heilige Leiber, Dreißigjährige Krieg, Wittelsbach, Gnadenbilder, Franziskanerordens, Jakobidult, Katakombenheiligen, Klarissen, Visitatio