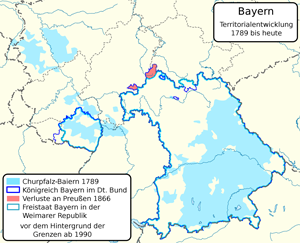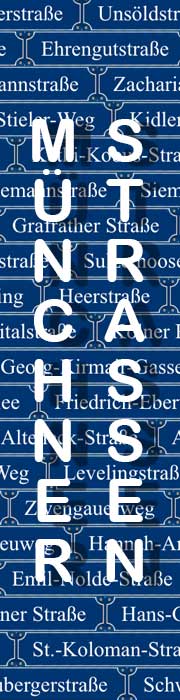Stadtgeschichte München
Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Geschichte
-
München: Fanny Ickstatt springt von der Frauenkirche in den Tod

Fanny Ickstatt springt aus Liebeskummer vom nördlichen Turm der Frauenkirche in den Tod. Ihr tragisches Ende war ein schockierendes Ereignis und erregte großes Aufsehen in der Gesellschaft. Der Vorfall führte zu zahlreichen Spekulationen und Diskussionen über die möglichen Gründe für ihren Suizid, darunter familiäre und persönliche Probleme.
Johann Wolfgang von Goethe, einer der bedeutendsten Dichter und Denker Deutschlands, nahm sich des tragischen Schicksals von Fanny von Ickstatt in seinem Werk „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ an. Der Vorfall von 1785, bei dem sich Fanny von der Frauenkirche in München stürzte, diente Goethe als Inspiration für die Figur der Mignon und die Themen des unerfüllten Lebens und tragischer Leidenschaften. Durch diese literarische Bearbeitung erhielt das Schicksal von Fanny von Ickstatt eine überregionale und zeitlose Bedeutung, die weit über das damalige Ereignis hinausging.
London: Selbstmord des Aussenministers Viscount Castlereagh.Affäre Redl: Spionagechef 1913 enttarnt und begeht Selbstmord
Die Affäre um Alfred Redl, den Chef des k.u.k. Kundschaftsdienstes, entfaltete sich im Mai 1913. Redl, der sich als Spion für Russland betätigte, wurde am 25. Mai 1913 enttarnt und beging am darauffolgenden Tag Selbstmord, um einer Verhaftung zu entgehen. Die Enthüllung seiner Spionagetätigkeit führte zu einem der größten Geheimdienstskandale der damaligen Zeit.
Selbstmord Michail Tomskis1936 beging Michail Tomski, ein führendes Mitglied der Bolschewiki und Gewerkschaftsführer in der Sowjetunion, Selbstmord. Sein Tod erfolgte in einer Zeit intensiver politischer Säuberungen unter Josef Stalin, den sogenannten "Stalinistischen Säuberungen" oder "Großen Terror". Tomski war einer der letzten überlebenden Altbolschewiki, die nach der Oktoberrevolution von 1917 eine bedeutende Rolle gespielt hatten. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch die stalinistischen Repressionen, bei denen zahlreiche seiner Genossen verhaftet und hingerichtet wurden, sah Tomski offenbar keinen Ausweg mehr und nahm sich das Leben. Sein Selbstmord war ein Vorbote für die blutigen Säuberungen, die viele der ursprünglichen Führer der russischen Revolution auslöschten.
Selbstmord des Generaloberst UdetBerlin: Selbstmord Hitlers; Nachfolger Admiral DönitzAdolf Hitler beging am 30. April 1945 in seinem Bunker in Berlin Selbstmord, als die Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg absehbar war. Nach seinem Tod übernahm Großadmiral Karl Dönitz als sein Nachfolger die Führung des Deutschen Reiches.
Selbstmord Hermann Görings
Hermann Göring, einer der ranghöchsten NS-Funktionäre, entzog sich seiner Hinrichtung nach den Nürnberger Prozessen durch Selbstmord. Trotz strenger Überwachung gelang es ihm, eine Giftkapsel zu verstecken und einzunehmen. Sein Tod verhinderte die Vollstreckung des Todesurteils, das wegen seiner führenden Rolle im NS-Regime und zahlreicher Kriegsverbrechen gegen ihn verhängt worden war. Görings Selbstmord wurde zum Symbol für die Verleugnung von Verantwortung und die Unfähigkeit, sich den Konsequenzen seiner Taten zu stellen.
Freitod von Jürgen Möllemann
Jürgen Möllemann, ein prominenter FDP-Politiker, stand wegen Korruptionsvorwürfen und Ermittlungen zu illegalen Parteispenden sowie Steuerhinterziehung unter erheblichem Druck. Seine umstrittenen Äußerungen, die als antisemitisch kritisiert wurden, führten zu heftigen Debatten und parteiinternen Konflikten. Inmitten dieser Entwicklungen nahm er sich während eines Fallschirmsprungs das Leben. Sein Tod löste Diskussionen über die Auswirkungen politischer und rechtlicher Belastungen aus und hinterließ eine vielschichtige Bewertung seiner politischen Karriere und persönlichen Entscheidungen.
Deutschland
Friedrich Ebert
(Reichspräsident
1919-1925)
Dr. Walter Simons
(Reichspräsident (kommißarisch)
1925-1925)
Paul von Hindenburg
(Reichspräsident
1925-1934)
Wilhelm Marx
(Reichskanzler
1923-1925)
Hans Luther
(Reichskanzler
1925-1926)
Kirchenstaat
Pius XI. (1922-1939)