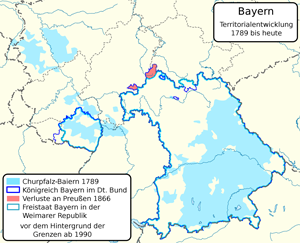Stadtgeschichte München
Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Geschichte
-
Synagoge im JudengäßchenMünchen: Jüdisches Gemeindeleben in der Gruftgasse
In der „Judengasse“, der späteren Gruftgasse, entstehen eine Synagoge sowie ein Spital zur Versorgung bedürftiger Mitglieder der jüdischen Gemeinde (Hekdesch). Wenig später werden auch ein rituelles Bad (Mikwe) und eine Fleischbank eingerichtet.
München: Die Synagoge wird zur Kirche umgebautDie Synagoge wird nach der Vertreibung der Juden von Johann Hartlieb zur Marienkapelle umgebaut.
München: Bau einer Synagoge in der Theaterstraße
In der Theaterstraße (heute Westenriederstraße) entsteht eine neue Synagoge, entworfen vom königlichen Baurat Jean Baptiste Métivier. Sie wird zum zentralen religiösen Versammlungsort der jüdischen Gemeinde in München.
München: Die Synagoge in der Westenriederstraße wird eingeweiht
1826 wurde erstmals wieder eine Synagoge in der Westenriederstraße feierlich eingeweiht.
München: Einweihung der Hauptsynagoge an der Herzog-Max-StrasseDie Hauptsynagoge wurde von Albert Schmidt im neuromantischen Stil erbaut.
München: Eröffnung der Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße
Die Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße wird fertiggestellt und eröffnet. Als drittgrößte Synagoge Deutschlands dient sie als religiöses und kulturelles Zentrum der liberal ausgerichteten jüdischen Gemeinde in München.
München: Einweihung der Ohel-Jakob-Synagoge
Die orthodoxe jüdische Gemeinde in München weiht ihre neue Ohel-Jakob-Synagoge in der Canalstraße (heute Herzog-Rudolf-Straße) ein. Die Synagoge dient als religiöses Zentrum für die strenggläubigen Juden der Stadt und ermöglicht ihnen eine eigenständige Glaubenspraxis. Mit der Errichtung dieses Gotteshauses festigt die orthodoxe Gemeinschaft ihre organisatorische und spirituelle Unabhängigkeit innerhalb der jüdischen Gemeinde Münchens und setzt ein Zeichen für die Vielfalt jüdischen Lebens in der Stadt.
München: Neue Synagoge in der ReichenbachstraßeOsteuropäische Juden richten in der Reichenbachstraße eine eigene Synagoge ein, die ihrer religiösen Tradition entspricht.
Reichsprogromnacht: reichsweite Pogrome gegen Juden und Synagogen; über 400 ToteSynagogengemeinden verlieren ihren rechtlichen StatusEin neues Gesetz entzieht allen jüdischen Synagogengemeinden ihren Status als Körperschaften des öffentlichen Rechts. Fortan werden sie nur noch als Vereine geführt, was ihre Rechte und Handlungsmöglichkeiten erheblich einschränkt.
München: Die Hauptsynagoge wird abgebrochenBereits Wochen vor der Reichspogromnacht ließ das NS-Regime die Münchner Hauptsynagoge am Lenbachplatz zerstören. Adolf Hitler störte sich bei einem Stadtbesuch an ihrem Anblick, woraufhin der Abbruch angeordnet wurde. Der Bauunternehmer Leonhard Moll erhielt den Auftrag, die Synagoge bis zum 8. Juli 1938 – dem Tag der Deutschen Kunst – vollständig zu entfernen. An ihrer Stelle entstand ein Parkplatz. Gleichzeitig wurde die Israelitische Kultusgemeinde gezwungen, ihre Verwaltung und den Betsaal in eine ehemalige Tabakwarenfabrik in der Lindwurmstraße zu verlegen.
München: Synagoge im ehemaligen SchwesternheimDie Displaced Persons richten im ehemaligen Schwesternheim in der Möhlstraße eine Synagoge ein.
München: Wiedereröffnung der Synagoge in der ReichenbachstrasseDie nach dem Krieg erhaltene Synagoge in der Reichenbachstraße wird zur Hauptsynagoge der Israelitischen Kultusgemeinde.
München: Einweihung des Holocaust -Mahnmals an der Herzog-Max-Straße
An dem Standort der früheren Hauptsynagoge (Herzog-Max-Straße) wurde der Gedenkstein zum Gedenken an die jüdischen Opfer des Holocaust in München, eingeweiht.
München: Beschluss für neues Jüdisches ZentrumDie Stadt München und die Israelitische Kultusgemeinde entscheiden sich für den Bau eines neuen Jüdischen Zentrums am St.-Jakobs-Platz. Das Projekt umfasst eine Synagoge, ein Gemeindezentrum und ein von der Stadt getragenes Jüdisches Museum.
München: Einweihung der neuen Hauptsynagoge am Jakobsplatz
Das Datum wurde zur Erinnerung an die Reichsprogromnacht, bei der die staatlich gebilligten Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung und deren Synagogen und Geschäften stattfanden.
Halle: Anschlag von Halle
Ein rechtsextremistischer Täter versuchte, eine Synagoge in Halle während eines jüdischen Feiertags anzugreifen. Nachdem sein Vorhaben scheiterte, weil die Tür der Synagoge standhielt, erschoss er eine Passantin und später einen Mann in einem Döner-Imbiss. Der Angriff wurde live im Internet übertragen, was für internationale Bestürzung sorgte. Der Täter handelte aus antisemitischen und rassistischen Motiven.
Deutschland
Friedrich Ebert
(Reichspräsident
1919-1925)
Dr. Walter Simons
(Reichspräsident (kommißarisch)
1925-1925)
Paul von Hindenburg
(Reichspräsident
1925-1934)
Wilhelm Marx
(Reichskanzler
1923-1925)
Hans Luther
(Reichskanzler
1925-1926)
Kirchenstaat
Pius XI. (1922-1939)